Wirkung statt Wohlklang
Warum die Unterscheidung von Input, Output, Outcome und Impact oft förderentscheidend ist und wie das IOOI-Modell dazu beiträgt, Wirkungszusammenhänge zwischen eingesetzten Ressourcen und angestrebten Zielen darzustellen.
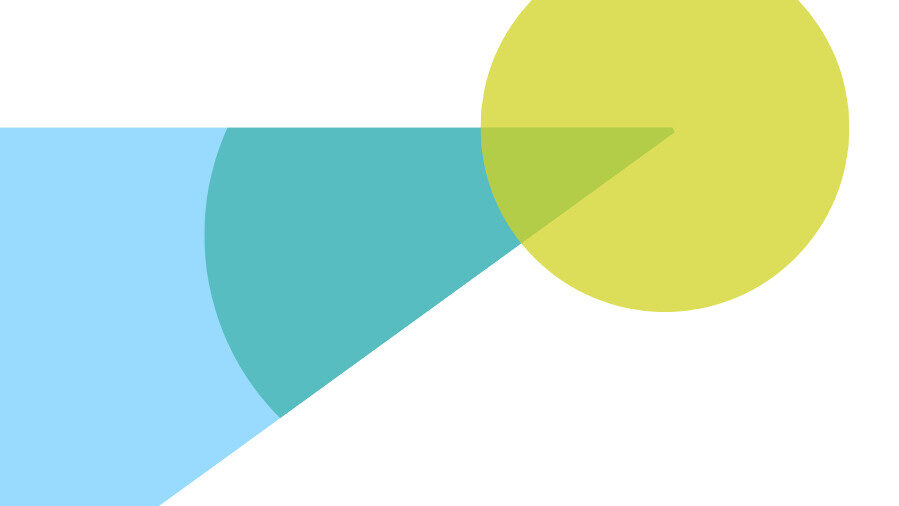
In vielen Projektanträgen liest man Sätze wie „Wir möchten Kinder stärken“, „Wir wollen Teilhabe ermöglichen“ oder „Wir fördern demokratische Werte“. Klingt gut – bleibt aber oft vage. Wer Fördermittel einwerben oder den Erfolg seiner Arbeit nachvollziehbar dokumentieren will, sollte Wirkungszusammenhänge klarer benennen können. Das IOOI-Modell bietet hierfür eine hilfreiche Struktur: Es unterscheidet zwischen Input, Output, Outcome und Impact. Das IOOI-Modell hilft dabei, die Logik hinter einem Projekt transparent zu machen: Welche Mittel setzen wir ein, was tun wir damit, was ändert sich für die Zielgruppe – und was bedeutet das gesellschaftlich? Gerade bei Förderanträgen oder Projektberichten ist es entscheidend, zwischen Tun und Wirkung zu unterscheiden. Fördergeber wollen nicht nur wissen, was gemacht wurde – sondern vor allem: Was hat es gebracht?
Input und Output beschreiben konkrete Ressourcen und Leistungen
Der Input umfasst alle Ressourcen, die in ein Projekt investiert werden: Dazu zählen Personal, Zeit, finanzielle Mittel, Material, Infrastruktur und Know-how. Diese Ebene bildet das Fundament der Projektplanung, ist in der Regel am leichtesten zu quantifizieren und wird deshalb oft mit besonderer Sorgfalt im Finanzplan dokumentiert. Der Input ist dabei noch wertfrei: Er sagt nichts über die Qualität oder den Erfolg der späteren Projektdurchführung aus, sondern beschreibt lediglich, welche Mittel zur Verfügung stehen. Wenn beispielsweise zwei Sozialpädagoginnen und ein Honorartrainer gemeinsam ein Schulprojekt gegen Mobbing vorbereiten, könnte der Input wie folgt aussehen: Die Sozialpädagoginnen investieren insgesamt 40 Arbeitsstunden, die Honorarkraft wird für zehn Stunden beauftragt. Sie nutzen Bildungsmaterialien und Medien im Wert von 500 Euro sowie die erstellten Produkte. Hier geht es um das messbare, sichtbare Tun – noch nicht um dessen Wirkung oder Erfolg. Der Output lässt sich in der Regel präzise quantifizieren und dokumentieren. Wie viele Veranstaltungen wurden durchgeführt? Welche Materialien wurden erstellt? Wie viele Personen wurden erreicht? Diese Kennzahlen sind wichtig für die Rechenschaftslegung gegenüber Fördergebern, sagen aber noch nichts über die tatsächliche Wirksamkeit der Maßnahmen aus. Im beispielhaften Mobbing-Projekt würde der Output daher Folgendes umfassen: Die Pädagoginnen führen drei Workshops à 90 Minuten in der achten Klasse durch. Alle 75 erreichten Schüler:innen erhalten ein Begleitheft zum Thema „fairer Umgang“.
Abonnenten lesen mehr
Als Abonnent lesen Sie die Volltexte für alle Online-Artikel und haben Zugang zu unserem großen Archiv.
Ganze Ausgabe als ePaper
Abonnenten haben vollen Zugriff auf alle Inhalte.

